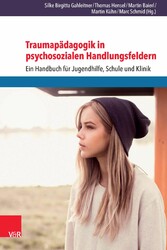
Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern - Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik
von: Thomas Hensel, Martin Baierl, Martin Kühn, Marc Schmid, Silke Birgitta Gahleitner, Thomas Hensel, Martin Baierl, Martin Kühn, Marc Schmid
Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, 2017
ISBN: 9783647402406
Sprache: Deutsch
296 Seiten, Download: 5282 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern - Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik
| Cover | 1 | ||
| Title Page | 4 | ||
| Copyright | 5 | ||
| Table of Contents | 6 | ||
| Body | 10 | ||
| Silke Birgitta Gahleitner / Thomas Hensel / Martin Baierl / Martin Kühn / Marc Schmid: Zur Einführung | 10 | ||
| Literatur | 16 | ||
| Grundlagen des neuen Traumaparadigmas | 18 | ||
| Martin Kühn: Traumapädagogik – von einer Graswurzelbewegung zur Fachdisziplin | 20 | ||
| Einleitung | 20 | ||
| Die Wurzeln der Traumapädagogik | 21 | ||
| Der Beitrag der Pädagogik in der psychosozialen Versorgung traumatisierter Kinder und Jugendlicher | 22 | ||
| Literatur | 26 | ||
| Thomas Hensel: Die Psychotraumatologie des Kindes- und Jugendalters | 28 | ||
| Vorbemerkungen | 28 | ||
| Die Psychotraumatologie des Kindes- und Jugendalters – Historie | 30 | ||
| Klassifikation von Traumafolgestörungen | 31 | ||
| Diagnoseorientierte Klassifikationen | 31 | ||
| Altersorientierte Klassifikationen | 32 | ||
| Klassifikationen komplexer Traumafolgestörungen | 32 | ||
| Epidemiologie und Risikofaktoren | 34 | ||
| Therapeutisch-pädagogische Hilfe | 35 | ||
| Psychotherapie von Traumafolgestörungen | 35 | ||
| Traumapädagogik des Alltags | 35 | ||
| Abschließende Bemerkung | 36 | ||
| Literatur | 36 | ||
| Die pädagogische Triade der Traumapädagogik | 40 | ||
| Detlev Wiesinger / Wolfgang Huck / Marc Schmid / Ulrike Reddemann: Struktur- und Prozessmerkmale traumapädagogischer Arbeit in der stationären Jugendhilfe | 42 | ||
| Vorbemerkung | 42 | ||
| Qualitätsmerkmale für die Ausgestaltung von Angeboten | 42 | ||
| Klientenbezogene Qualitätsmerkmale | 43 | ||
| Mitarbeiterbezogene Qualitätsmerkmale | 47 | ||
| Nachsorge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach außergewöhnlichen Belastungssituationen in der Jugendhilfe | 48 | ||
| Organisationsbezogene Merkmale | 50 | ||
| Strukturmerkmale | 51 | ||
| Gruppengröße und -zusammensetzung | 51 | ||
| Teamgröße und -zusammensetzung | 52 | ||
| Räumlichkeiten, Ausstattung und Lage | 53 | ||
| Leitungs- und Unterstützungssystem | 54 | ||
| Personal | 54 | ||
| Prozessmerkmale | 55 | ||
| Aufnahme- und Entlassungsprozesse, Hilfeplanung | 55 | ||
| Steuerung der Hilfeprozesse | 56 | ||
| Steuerung der Gruppensituation | 56 | ||
| Teambalance | 56 | ||
| Kommunikationsprozesse mit Umfeld und Partnern | 57 | ||
| Schlussbemerkung | 57 | ||
| Literatur | 58 | ||
| Martin Baierl / Cornelia Götz-Kühne / Thomas Hensel / Birgit Lang / Jochen Strauss: Traumaspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 60 | ||
| Vorbemerkungen | 60 | ||
| Haltungsdimensionen gegenüber den Kindern | 61 | ||
| Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen | 62 | ||
| Bereitschaft zum lebenslangen Lernen | 64 | ||
| Selbsterfahrung und Supervision | 65 | ||
| Aktive Selbstfürsorge: Schutz vor sekundärer Traumatisierung und Burnout-Prävention | 67 | ||
| Kollegialer Einsatz für förderliche Rahmen- und Arbeitsbedingungen in der traumapädagogischen Arbeit | 68 | ||
| Literatur | 71 | ||
| Martin Baierl: Traumaspezifische Bedarfe von Kindern und Jugendlichen | 73 | ||
| Vorbemerkungen | 73 | ||
| Äußere Sicherheit herstellen und Sicherheitsbedürfnisse des Kindes befriedigen | 74 | ||
| Regeln, Absprachen und Strukturen | 75 | ||
| Soziale Kontakte | 77 | ||
| Transparenz und Partizipation | 78 | ||
| Gefühlte Sicherheit | 79 | ||
| Bindungs- und Beziehungsfähigkeit | 79 | ||
| Etablieren und Fördern selbstregulatorischer Fähigkeiten | 81 | ||
| Emotionale Stabilität und Kontrolle | 81 | ||
| Körperliche Stabilität und Kontrolle | 82 | ||
| Stabilität und Kontrolle des Verhaltens | 82 | ||
| Unterstützung der Informationsverarbeitung und Selbstreflexivität | 83 | ||
| Lebensfreude | 84 | ||
| Integration von traumatischen Erfahrungen | 84 | ||
| Spiritualität | 85 | ||
| Familienarbeit | 85 | ||
| Akute Traumatisierung während einer Betreuung | 86 | ||
| Literatur | 87 | ||
| Arbeitsfelder und Zielgruppen der Trauma pädagogik 1: Pädagogik und Soziale Arbeit | 90 | ||
| Gerald Möhrlein / Eva-Maria Hoffart: Traumapädagogische Konzepte in der Schule | 92 | ||
| Vorbemerkungen | 92 | ||
| Lernen in der Schule auf verschiedenen Ebenen | 93 | ||
| Auswirkungen von Traumafolgestörungen auf das Lernen und die exekutiven Funktionen | 93 | ||
| Auswirkungen der belastenden schulischen Lebenserfahrungen auf die Selbstwirksamkeit und das Selbstbild | 93 | ||
| Schule als Beziehungsfeld, in dem positive soziale Erfahrungen gemacht werden können | 94 | ||
| Struktur der Beschulung | 94 | ||
| Sonderpädagogik und Trauma | 96 | ||
| Was brauchen die Schulen? | 96 | ||
| Kooperation von Jugendhilfe und Schule | 97 | ||
| Was brauchen die Kinder? | 99 | ||
| Impulsfragen für Lehrkräfte | 101 | ||
| Schlussbemerkung | 101 | ||
| Literatur | 102 | ||
| Stefan Blülle / Silke Birgitta Gahleitner: Traumasensibilität in der Kinder- und Jugendhilfe | 104 | ||
| Hilfe und/oder Schutz? | 104 | ||
| Das Kindeswohl beurteilen und passende Hilfen indizieren | 105 | ||
| Jugendamtsmitarbeitende als Lotsen im Hilfeprozess | 109 | ||
| Fremdplatzierung: Wenn ambulante Hilfen nicht ausreichen | 111 | ||
| Inobhutnahme/Aufhebung der elterlichen Obhut | 113 | ||
| Schlussgedanken | 116 | ||
| Literatur | 117 | ||
| Marc Schmid / Tania Pérez / Martin Schröder / Yvonne Gassmann: Möglichkeiten der traumasensiblen/-pädagogischen Unterstützung von Pflegefamilien | 119 | ||
| Vorbemerkungen | 119 | ||
| Traumatische Erfahrungen und psychische Belastungenvon Pfl egekindern | 120 | ||
| Bedeutung der Bindung für Hilfsprozesse | 123 | ||
| Sozialpädagogische sowie kinder- und jugendpsychiatrische/-psychotherapeutische Unterstützungssysteme für Pflegefamilien | 124 | ||
| Die Rolle von Pflegefamilien in der langfristigen Hilfeplanung | 126 | ||
| »Sicherer Ort«, Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem und Behörden aus traumapädagogischer Perspektive | 130 | ||
| Fazit | 131 | ||
| Literatur | 132 | ||
| Martin Baierl: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) von traumatisierten Kindern und Jugendlichen | 134 | ||
| Vorbemerkungen | 134 | ||
| Spezifika von ISE | 135 | ||
| Punkt 1: Entscheidungsprozess und Partizipation der Adressaten | 135 | ||
| Punkt 2: Auswahl der Zielgruppe | 135 | ||
| Punkt 3: Freiwilligkeit der Teilnahme | 136 | ||
| Punkt 4: Zeitliche und räumliche Distanz zum Milieu | 136 | ||
| Punkt 5: Angemessene Vorbereitung der Maßnahme | 136 | ||
| Punkt 6: Kontinuität und Qualität in den Beziehungen | 137 | ||
| Punkt 7: Alltagsbezug, Nachbetreuung und Transfer | 137 | ||
| Punkt 8: Fachaufsicht, Kontrolle und Supervision | 138 | ||
| Punkt 9: Qualifikation der Betreuerinnen und Betreuer | 140 | ||
| Punkt 10: Besondere Bedeutung des Auslands | 140 | ||
| Schlussbemerkungen | 141 | ||
| Literatur | 142 | ||
| Wilma Weiß: Traumasensible Familienhilfe: Ein Beitrag zur Psychosozialen Traumatologie | 143 | ||
| Vorbemerkungen | 143 | ||
| Transgenerationale Weitergabe von traumatischen Erfahrungen | 144 | ||
| Traumareaktive Muster im System | 145 | ||
| Methodische Überlegungen | 146 | ||
| Die trauma(sozial)pädagogische Haltung | 147 | ||
| Fünf Phasen im Hilfeprozess | 148 | ||
| Institutionelle und professionelle Voraussetzungen | 149 | ||
| Schlussbemerkung | 150 | ||
| Literatur | 150 | ||
| Martin Baierl: Hilfen für Eltern traumatisierter Jungen und Mädchen | 152 | ||
| Vorbemerkungen | 152 | ||
| Haltung | 153 | ||
| Kooperation erarbeiten | 154 | ||
| Für Traumatisierung (mit-)verantwortliche Eltern | 156 | ||
| Spezifi sche Interventionen | 157 | ||
| Psychoedukation | 157 | ||
| Akzeptanz der Notwendigkeit zur eigenen Veränderung | 158 | ||
| Aufzeigen pädagogischer Handlungsmöglichkeiten | 159 | ||
| Formen von Elternarbeit | 159 | ||
| Literatur | 160 | ||
| Arbeitsfelder und Zielgruppen der Traumapädagogik 2: Therapeutischer und medizinischer Bereich | 162 | ||
| Andreas Krüger: Medizinische Versorgung | 164 | ||
| Einführung | 164 | ||
| Körpermedizinische Versorgungseinrichtungen | 164 | ||
| Medizinische Einrichtungen und allgemeine diagnostische Funktionen | 164 | ||
| Medizinische Maßnahmen können selbst traumatischen Stress bewirken und/oder traumatische Wiedererinnerungen auslösen | 166 | ||
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie: Stationäre Behandlungseinheiten, kinderpsychiatrische (Trauma-)Ambulanzen und Facharztpraxen | 167 | ||
| Stationärer Versorgungskontext | 167 | ||
| Ambulanter Versorgungskontext | 168 | ||
| Jugendhilfemitarbeiter unterstützen ihre Klienten bei Kontakten mit medizinischen Versorgungseinrichtungen | 171 | ||
| Literatur | 173 | ||
| Marc Schmid / Katharina Purtscher-Penz / Kerstin Stellermann-Strehlow: Traumasensibilität und traumapädagogische Konzepte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie | 175 | ||
| Vorbemerkungen | 175 | ||
| Die Ausgestaltung der Milieutherapie innerhalb statio närer kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung | 176 | ||
| Höhere Traumasensibilität im Bereich der Jugendhilfe/ -fürsorge und in der Kooperation mit dem Herkunftssystem | 178 | ||
| Partizipationsmöglichkeiten des Kindes und Jugendlichen in der kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlung und Hilfeplanung | 179 | ||
| Zwangsmaßnahmen in stationärer kinder- und jugendpsychiatrischer/-psychotherapeutischer Behandlung | 179 | ||
| Psychoedukation: Stärkere Förderung des Selbstverstehens von traumatisierten Patienten | 181 | ||
| Die Kooperation zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Jugendhilfe | 182 | ||
| Der Einsatz von kinder- und jugendpsychiatrischen Ressourcen an der Schnittstelle zur Jugendhilfe | 184 | ||
| Neue Formen der evidenzbasierten psychotherapeutischen Expositionsbehandlung von besonders belasteten Kindern | 184 | ||
| Die Notwendigkeit von entlastenden Strukturen für die Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendpsychiatrie/ -psychotherapie | 186 | ||
| Förderung der Biografiearbeit im Rahmen der Psychotherapie und der Hilfeplanung | 187 | ||
| Ausbildung von pädagogischem und kinder- und jugendpsychiatrischem Personal zur Begleitung komplex traumatisierter Kinder und Jugendlicher | 188 | ||
| Impulse für die kinder- und jugendpsychiatrische/ -psychotherapeutische Forschung | 189 | ||
| Schlussfolgerungen und Fazit | 190 | ||
| Literatur | 191 | ||
| Célia Steinlin-Danielsson / Marc Schmid: Traumasensibilität und traumapädagogische Haltung in der forensischen Psychiatrie | 193 | ||
| Vorbemerkungen | 193 | ||
| Der Einfl uss von traumatischen Erlebnissen auf die Entwicklung von Delinquenz | 194 | ||
| Gewalterfahrungen in der Familie | 198 | ||
| Zusammenhang zwischen familiären Gewalterfahrungen und Opfererfahrungen im Vollzug | 198 | ||
| Emotionale Entwicklung, Empathie und Psychopathie | 199 | ||
| Resilienzfaktoren | 200 | ||
| Traumasensibilität in der forensischen Begutachtung | 201 | ||
| Gefahren für forensische Gutachter | 204 | ||
| Traumasensibilität bei Inhaftierung und in stationären Maßnahmen | 205 | ||
| Traumasensibilität in forensischen Psycho- und Milieutherapien | 206 | ||
| »Sicherer Ort« und angemessene Versorgung für das Fachpersonal | 208 | ||
| Zusammenfassung und Ausblick | 209 | ||
| Literatur | 209 | ||
| Silvia Höfer: Vernetzung von ambulanter Traumapsychotherapie und Traumapädagogik | 211 | ||
| Beratung und Kooperation | 211 | ||
| Rahmenbedingungen der Psychotherapie | 213 | ||
| Aufgaben und Grenzen der Therapie | 215 | ||
| Gemeinsamkeiten von Psychotherapie und Pädagogik in der Arbeit mit traumatisierten Jungen und Mädchen | 217 | ||
| Kooperationsbedingungen und Kooperatio | 218 | ||
| Ausblick | 220 | ||
| Literatur | 221 | ||
| Arbeitsfelder und Zielgruppen der Traumapädagogik 3: Menschen mit speziellen Bedarfen | 224 | ||
| Martin Kühn / Julia Bialek: Traumatisierte Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen: Zum Auftrag der Pädagogik | 226 | ||
| Vorbemerkungen | 226 | ||
| Trauma und behindertes Leben | 227 | ||
| Risiken in der Familie als primärem Bindungsraum | 228 | ||
| Über-Leben in zwiespältigen Wirklichkeiten | 229 | ||
| Zum Referenzrahmen der Pädagogik in der Traumabearbeitung | 231 | ||
| Ausblick | 236 | ||
| Literatur | 237 | ||
| Martin Baierl: Traumapädagogik für Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrung | 240 | ||
| Vorbemerkung | 240 | ||
| Migration | 240 | ||
| Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 244 | ||
| Implikationen für die Traumapädagogik | 245 | ||
| Literatur | 249 | ||
| Traumapädagogische Praxis und Forschung | 250 | ||
| Silke Birgitta Gahleitner / Ingeborg Andreae de Hair / Dorothea Weinberg / Wilma Weiß: Traumapädagogische Diagnostik und Intervention | 252 | ||
| Traumapädagogische Diagnostik | 252 | ||
| Erster Schritt: Klassifi katorische Diagnostik | 253 | ||
| Zweiter Schritt: Biografi ediagnostik | 254 | ||
| Dritter Schritt: Lebensweltdiagnostik | 255 | ||
| Die Nutzung psychosozialer Diagnostik zur Interventionsplanung | 256 | ||
| Traumapädagogische Intervention | 258 | ||
| Warum psychosozial? | 258 | ||
| Erster Schritt: Sicherheit herstellen | 259 | ||
| Zweiter Schritt: Trauma- und Problembewältigung unterstützen | 260 | ||
| Dritter Schritt: Integration in den Lebensalltag | 262 | ||
| Besondere Aspekte traumapädagogischer Intervention | 263 | ||
| Die Pädagogik der Selbstbemächtigung – ein Kernstück der Traumapädagogik | 264 | ||
| Umgang mit aggressiven Verhaltensdysregulationen | 267 | ||
| Tiergestützte Interventionen im Kontext der Traumapädagogik am Beispiel des »Trauma-Tipis« | 272 | ||
| Literatur | 277 | ||
| Silke Birgitta Gahleitner / Marc Schmid: Traumapädagogische Forschung und Qualitätssicherung | 281 | ||
| Vorbemerkungen | 281 | ||
| Forschungsorientierung in der Traumapädagogik | 282 | ||
| Methodische Probleme und Chancen in der Forschung der Traumapädagogik | 284 | ||
| Best-Practice-Beispiele | 287 | ||
| KATA-TWG: Verbindung von qualitativen und quantitativen Methoden | 287 | ||
| Zeitreihenanalysen und Aufbau von kontinuierlichen Qualitätssicherungsprogrammen | 288 | ||
| Abschließende Bemerkungen | 290 | ||
| Literatur | 292 | ||
| Die Autorinnen und Autoren | 295 |







